Evangelium und Existenz
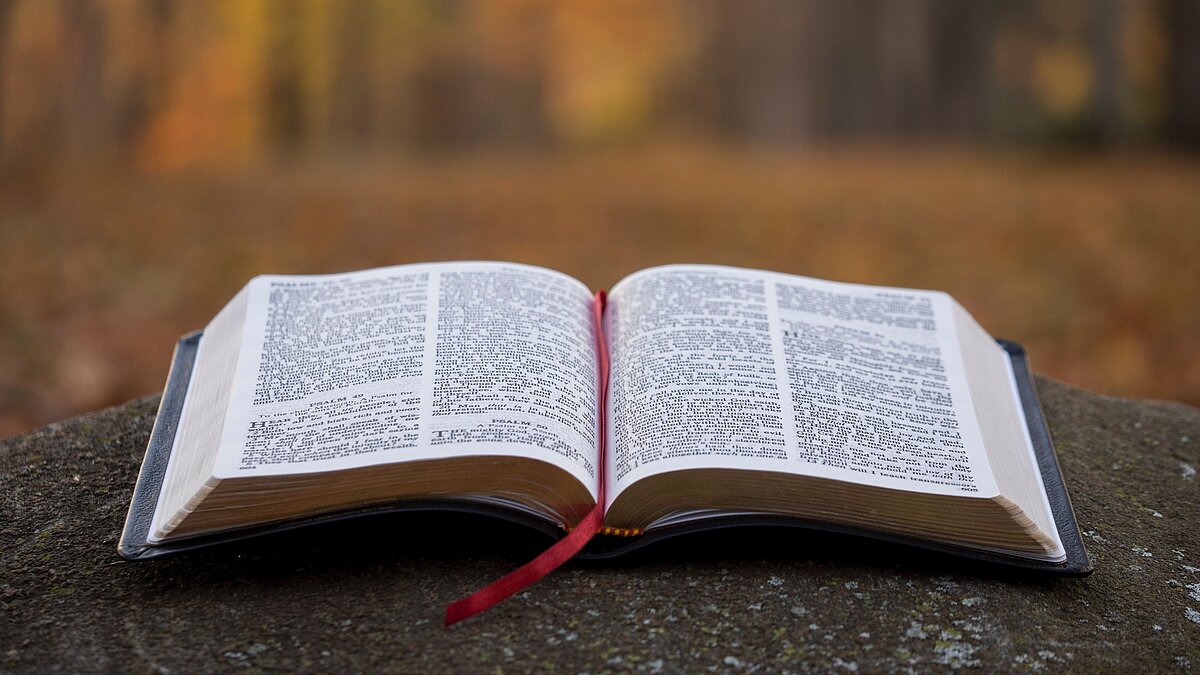
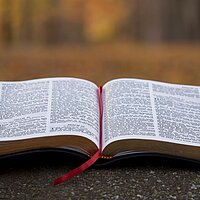
NETZ-Interview mit Professor Jan Loffeld und Pastoralreferentin Monika Stanossek. Der Teil, der nicht im NETZ-Magazin abgedruckt ist, beginnt nach den Porträtbildern. Viele Freude bei der Lektüre!
Der Autor und Publizist Erik Flügge hat in seinem Buch „Eine Kirche für viele statt heiligem Rest“ einen grundsätzlichen Wandel in der Pastoral gefordert. Ein Großteil der Ressourcen werde für lediglich zehn Prozent der Gläubigen ausgegeben. Herr Professor Loffeld, brauchen wir eine Wende in der Pastoral?
Loffeld: In seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium beschreibt Papst Franziskus einen pastoralen Transformationsprozess mit dem Begriff „conversion pastorale“. Franziskus meint damit – nach Thomas von Aquin - dass die Wirklichkeit immer über einer Idee steht. Ich denke, wir brauchen dies tatsächlich: Ein Denken von der Wirklichkeit her, also ein neues Bottom-Up-Prinzip. Die Pastoral ist ein wichtiger locus theologicus (Ort theologischer Erkenntnis, a.d.R.), an dem sich zeigt, ob das, was wir sagen und tun, relevant ist. Theologische Diskurse beschäftigen sich heute vielfach mit Fragen der Plausibilität des Glaubens, etwa wie der Glaube verständlich gemacht werden kann. Da fehlt jedoch zumeist das, was für Menschen heute relevant ist. Lebenswelten lassen sich nämlich meist nicht allein philosophisch einholen. Im Sinne einer pastoralen Wende plädiere ich dafür, sich auf die heterogenen Perspektiven unserer Gesellschaft einzulassen und diese wahrzunehmen. Was lernen wir daraus für unsere Verkündigung?
Stanossek: Eine pastorale Wende ereignet sich für mich schon seit vielen Jahren. Seit meinem Dienstbeginn 1982 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich Gemeinden verändern und wie es in unseren Stadtteilen aussieht. Ich behaupte, wir erreichen weit mehr als zehn Prozent. Nicht durch den Gottesdienst, aber durch anderes: Kindergärten zum Beispiel oder durch unsere Sozialprojekte.
Loffeld: Es gibt für Menschen viele Schnittstellen und Berührungspunkte mit kirchlichem Leben. Die Frage, die dahintersteht, lautet, wie wir Gemeinde und Gemeinschaft, theologisch Communio, verstehen. Die heutige noch wirksame Gemeindetheologie, die ihre Wurzeln in den 60er oder 70er Jahre hat, betonte stark ein kontinuierliches Miteinander. Damit gingen nicht selten exklusive Tendenzen einher. Eine Wende muss auch eine Weiterentwicklung der Gemeindetheologie beinhalten: Es gilt, Leute nicht nur zu sammeln, sondern sie auch wieder gehen zu lassen: sie zu senden. Dabei könnte das Situative viel stärker bedacht werden. Gemeinde oder Communio als Monopolkonzept muss an heutige Bedürfnisse angepasst werden. Es gibt dabei sicher nicht die eine Lösung. Das, was kommt und de facto vielfach schon da ist, wird eine sehr plurale Weise des Kircheseins und eine ziemlich anstrengende Heterogenität sein, die etwa auf der Ebene von Großpfarreien oder Diözesen vernetzt werden muss.
Stanossek: Es braucht Sammlung und Sendung, Orte, wo Menschen zusammenkommen und Gemeinschaft erleben können. Im Europaviertel in Frankfurt gibt es da zum Beispiel jetzt das Pax & People, wo sich Menschen treffen können. Es handelt sich um ein ökumenisches Angebot und wird gut angenommen – besonders die Kochkurse. Diese Menschen werden jetzt nicht auf ewig da bleiben. Dort sind Leute, die ein paar Jahre da sind, dann aber beruflich weiterziehen. Zumindest für diese Zeit finden sie einen Anlaufpunkt.
Loffeld: Ich nenne das Heimat im Standby. Nichtsdestotrotz ist die heutige territoriale Pfarrstruktur die größte Ermöglichungsstruktur, die wir haben. Wir dürfen sie nur nicht communio-ekklesiologisch eng führen und dann vorgeben, welche Form von Gemeinschaft vor allem katholisch ist und welche nicht. Menschen, die Kirchensteuer bezahlen und sich nur alle fünf Jahre in der Gemeinde blicken lassen, sind nicht Katholiken zweiter Klasse. Es braucht eine Art „sakramentale Gerechtigkeit“, denn alle sind gleichermaßen getauft. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier – etwa im Bereich von Trauungen – Kontakte, die die seelsorgliche Geduld auf eine harte Probe stellen können…
Warum tun wir uns als Kirche mit Veränderung so schwer? Warum braucht es dafür so lange?
Stanossek: Wir haben ja nicht nichts gemacht. Vor 37 Jahren war Kirche in Frankfurt eine andere. Es gab starke Gruppen, die das Gemeindeleben gestaltet haben. Die sind heute verschwunden. Ich glaube auch, dass sich etwas im Bewusstsein der Menschen verändert hat und es heute ein offeneres Denken gibt, etwa mit Blick auf das Thema Ökumene und für die Frage, wie man für Menschen in Not da sein kann. Aber natürlich muss in der Praxis auch Kopf und Bauch zusammenkommen. Besonders Ältere sehnen sich nach dem zurück, was früher schön war. Warum sollte man es ihnen auch verdenken? Sie müssen sich nicht mehr verändern. Die Jüngeren müssen schauen, wie es weitergeht.
Loffeld: Kirche ist ein Großsystem. Das ist Segen und Fluch zugleich. Veränderungsprozesse in solchen überkomplexen Systemen wie einer Weltkirche brauchen Zeit. Gerade Amoris Laetita hat aber gezeigt, dass Veränderung möglich ist. Der Papst hat ja hier das Gewissen stark gemacht und damit eine innerhalb der kirchlichen Moralverkündigung beinahe vergessene Instanz gestärkt. Ich glaube insgesamt, dass wir in einem epochalen Umbruch stehen, den wir Säkularisierung nennen können und den wir immer noch nicht wirklich als Zeichen der Zeit gewürdigt haben. Wir denken vielfach, es werde schon besser, wenn wir an der einen oder anderen Stellschraube drehen. De facto verfolgen wir ein Konzept nach dem anderen. Dabei müssten wir den gesamtkulturellen Umbruch zunächst einmal wirklich wahrnehmen und theologisch würdigen, um dann zu fragen, wie wir innerhalb solcher Kontexte evangelisierend und prophetisch sein können.
In vielen Bistümern werden Pfarreien zusammengelegt, die Zahl der Gottesdienstbesucher sinkt, die Katholikenzahl geht ebenfalls zurück. Frustriert Sie das? Fühlen Sie sich da hinterfragt?
Loffeld: Eine gewisse Gestalt von Kirche, kirchliche Konstellation, wird radikal transformiert: das sog. Territorial- bzw. Pfarrprinzip, das wir vom Trienter Konzil her kennen. Aber das Evangelium kommt nicht an sein Ende. Ich erlebe in Holland derzeit sehr konkret, dass das Evangelium weiter lebt, häufig in einer ganz anderen Weise, als wir es uns vorstellen oder planen könnten. Daher bin ich überhaupt nicht pessimistisch. Ich denke, dass wir eine Grundeinsicht des Konzils neu entdecken dürfen: Die Kirche ist dafür da, dass Christus das Licht der Welt wird und Menschen in Christus das Heil finden. Sie ist kein Zweck an sich. Es geht daher nicht darum, die Kirche zu retten. Viele Pastoralkonzepte lese ich so, dass sie die Kirche oder eine bestimmte Form von Kirche erhalten möchten. Sie meinen, nur dann und so bleibt auch das Evangelium lebendig.
Pastoral basiert auf Beziehungen und Kontakt. Zugleich werden die pastoralen Räume immer größer. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um?
Loffeld: Ich schließe mich da dem Verdacht von Paul Zulehner an, dass sich die strukturellen Veränderungen vor allem an der Zahl der zur Verfügung stehenden und leitungsfähigen Priester orientieren. Dahinter steht ein eucharistiezentrisches Kirchenbild. Muss nicht aber der Grundauftrag der Kirche weiter gedacht werden, nämlich, dass sich das Evangelium mit konkreter menschlicher Existenz verbindet und die Kirche auch auf diese Weise „Sakrament“ im Sinne von Lumen Gentium 1 ist? Das geschieht zweifelsohne und unübertroffen in der Eucharistie, aber auch andernorts, überall, wo die Kirche sich als „Sakrament des Heils“ versteht: in einem allgemein sakramententheologischen wie im speziellen Sinne der sieben Sakramente. Müssten wir daher nicht mehr danach fragen, an welchen Orten und bei welchen Gelegenheiten Menschen heilsame Erfahrungen mithilfe des Glaubens machen können? Das relativiert keineswegs den sakramentalen Grundauftrag der Kirche, sondern erweitert und verwirklicht ihn im Sinne des Konzils.
Stanossek: Es braucht auch in der Pfarrei neuen Typs Menschen vor Ort, die ansprechbar sind, die einen Überblick haben, vernetzen und Verbindungen schaffen können. Ob das jetzt Hauptamtliche oder Ehrenamtliche sind, muss man ausprobieren. Es gibt ja bereits ehrenamtliche Teams, die am Kirchort Gemeindeleitung wahrnehmen. Ich finde das spannend, was sie für Erfahrungen machen. Es braucht Menschen, von denen andere wissen: „Da kann ich mich hinwenden. Auch wenn es nichts Großes ist.“
Ich möchte mit Blick auf Haupt- und Ehrenamt die Ressourcenfrage stellen. Im Bistum Limburg gibt es ja im Verhältnis zur gesamten Katholikenzahl eine hohe Zahl von Seelsorgerinnen und Seelsorger. Manche sagen sogar: Limburg ist überversorgt. Sollten wir stärker auf das Ehrenamt setzen oder sollten Ressourcen stärker in Personal investiert werden.
Stanossek: Ich kann mir gut vorstellen, dass Ehrenamtliche in Frankfurt eine verlässliche Präsenz vor Ort sein können. Man muss vor Ort schauen: Gibt es Menschen, die ehrenamtlich etwas übernehmen können. Falls nicht, braucht es Hauptamtliche. Diese müssen aber nicht ausschließlich dafür zuständig sein. Dieses „Nah am Ort“ sein, gehört für mich viel stärker in die Ausbildung von Hauptamtlichen. Ich habe derzeit den Eindruck, dass sich Hauptamtliche stärker als Referentinnen und Referenten verstehen sollen. Sie sind dann Spezialistinnen oder Spezialisten in einem oder zwei Bereichen einer Pfarrei. Das Generalistentum ist in Verruf geraten. Das finde ich schade. Es braucht von Beidem etwas.
Loffeld: Ich würde das mit einem klassisch katholischen Prinzip der Subsidiarität beantworten. Lässt sich das sozialethische Prinzip nicht auch auf die Pastoral anwenden? Wenn in einer Gemeinde wirklich nichts mehr geht, dann sollte darüber nachgedacht werden, etwas zusammenzulegen. Sicher muss da auch die Stadt-Land Differenz bedacht werden und wieder gilt: es kann nicht die eine gute Lösung für alle oder alles geben. Das ist ein offenes Experiment und es bedarf des guten Zuhörens, eines wirklichen Bottom-Up-Prinzips aber auch irgendwann mal einer verantworteten Entscheidung seitens der Leitung.

Sie haben die Ausbildung angesprochen. Was brauchen pastorale Mitarbeiter aktuell aber auch künftig an Qualitäten, damit Glaubensweitergabe gelingen kann?
Stanossek: Ich finde wichtig, dass eine Freude da ist, etwas mit Menschen zu entwickeln. Ich habe bereits Kollegen erlebt, die menschenscheu waren. Es braucht eine Bereitschaft, sich einzulassen auf Situationen, auf Menschen, auf Veränderungen, auf das, was Menschen, die zu uns kommen, eben mitbringen.
Loffeld: Die Zeit, einen Methoden- oder Handlungskoffer mitzugeben, ist vorbei. Es geht heute um Persönlichkeitsbildung und die Begleitung in eine Haltung hinein. Ambiguitätstoleranz finde ich wichtig. Viele pastorale Situationen sind heute sehr herausfordernd. Wichtig halte ich auch eine theologische Kompetenz. Es gibt sehr wohl so etwas wie einen pastoralen Populismus – also auf komplexe Situationen einfache Antworten – etwa in einer simplen Predigt - zu geben. Daneben sehe ich auch eine spirituelle Kompetenz, nämlich das Gespür und die Offenheit dafür, was Gott mir beispielsweise durch eine Begegnung sagen möchte. So etwas kann natürlich auch irritieren. Aber das gehört zur Spiritualität dazu.
Welche Bedeutung haben in diesem Kontext Begriffe wie Innovation und Kreativität?
Loffeld: Ich habe bei solchen Begriffen manchmal den Verdacht, dass es sich um bloße Füllvokabeln handelt, und mit denen man Zustimmung erhält, wenn man sie verwendet. Ich finde, solche Begriffe müssen auch wirklich zu Konsequenzen führen. Beispielsweise beim Thema Innovationen. Was ist denn mit jemanden, der in der Pastoral eine innovative Idee hat? Bekommt er finanzielle Unterstützung? Hat das wirklich einen Stellenwert für uns? Gibt es einen Haushaltsposten, bei dem man nicht erst viele Anträge schreiben muss?
Dem Bischöflichen Ordinariat wird häufig vorgeworfen, Innovationen in Pfarreien auszubremsen. Vielfach würden Ideen entwickelt, die dann aber nicht umgesetzt werden können. Erleben Sie das auch so?
Stanossek: Meine Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamtliche und ich selbst auch fühlen uns da jetzt nicht ständig ausgebremst. Es gibt aber einige Dinge, die uns manches schwer machen. Beispielsweise wurden die Stellen für Hausmeister und Küster gekürzt. Auch die Sekretariate bekommen mehr aufgebürdet – beispielsweise beim Datenschutz oder dem Rechnungswesen – und gleichzeitig werden Stellen gekürzt. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir inhaltlich ausgebremst werden oder dass es an Geld mangelt bei pastoralen Projekten.
Loffeld: In Holland erlebe ich eine pragmatische Herangehensweise. Da wird etwas ausprobiert und später geschaut, ob es geklappt hat. Das ist eine gute Weise von Ermöglichungsstruktur, von der wir vielleicht lernen können. Bei uns zeigt sich meines Erachtens eher eine Bedenkenstruktur.
Investieren wir als Kirche zu stark in den Erhalt von Strukturen statt in Entwicklung?
Loffeld: Gisbert Greshake hat einmal gesagt wir funktionieren nach dem Motto „Halten, was zu halten ist und retten, was zu retten ist“. Er hat nicht Unrecht. Aber da hängen natürlich auch bestimmte Existenzen, Geschichten und generationenspezifische Bilder dran. Deshalb gibt es auch hier keine einfachen Antworten. Was viel wichtiger finde, ist, an unseren inneren Bildern zu arbeiten und nicht in Strukturen zu investieren, die merklich nicht mehr funktionieren. Wir müssen kritisch schauen, was wir mit in die Zukunft nehmen und was nicht. Die Communio-Theologie hat sich nicht als das Lösungs- bzw. Heilskonzept herausgestellt, als das es nach dem Konzil gestartet ist.
Stanossek: In den Pfarreien geht es dabei häufig um die Frage der Gebäude. Nach der Visitation und dem Erscheinen des Visitationsberichtes gab es eine große Angst davor, dass Kirchen im Pfarrgebiet geschlossen werden müssten. An den Gebäuden hängen das Herz und ganze Lebensgeschichten. Von daher investieren wir natürlich in Bestehendes, das wir auf Dauer nicht alles erhalten können. Solange wir aber Menschen da haben, die zum Teil noch mit eigenen Händen, die Kirche aufgebaut haben, sollten wir da vorsichtig mit umgehen und Wege aufzeigen, wie man etwas erhalten kann, aber nicht alles in der jetzigen Form. Es braucht viel Fingerspitzengefühl auch von den Verantwortlichen vor Ort.
Loffeld: Ich möchte einen provokativen Gedanken stellen: Erhalten wir nicht zu viele bürgerliche, vereinsmäßige Strukturen, die sich nicht auch selbst tragen könnten? Und nochmals: nehmen wir auch außerhalb der kirchlichen „Filter-bubble“ Problemstellungen, völlig andere Lebensstile und Relevanzen wahr? Etwa die Frage, ob jeder Mensch wirklich religiös ist, Gott für sein Glück braucht oder Kirche bzw. Gemeinde als Lebensort. Die korrelative Grundannahmen, dass wir bei guter pastoraler Qualität - was ist das eigentlich? -, auch Menschen mit unseren Anliegen und Themen bewegen könnten, hat sich empirisch als nicht haltbar herausgestellt. Eher geht es heute darum, etwas anzubieten, was die meisten vielleicht auf den ersten Blick gar nicht gesucht haben – wie es eine Taufbewerberin in Frankfurt einmal aus ihrer Erfahrung heraus beschrieb. Hier wird sicher die Erfahrungsdimension des Glaubens vor und neben seiner rationalen Reflexion künftig wichtiger.
Die Auflösung von Pfarreien und die Aufgabe von Kirchen führen meist zu Frustration und großer Trauer bei Gläubigen. Haben Sie Tipps, wie man mit solchen Abschieds- und Trauerprozessen am besten umgeht?
Loffeld: Ernstnehmen und begleiten. Wenn ich mir manche Fortbildungsprogramme von Diözesen anschaue, könnte man fast meinen, solche Trauererfahrungen gäbe es nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es braucht mehr Orte, wo eine Trauer- und Ohnmachtserfahrung zum Thema werden kann. Das bietet auch die Chance, Perspektiven für das zu eröffnen, wo Neues wachsen kann oder bereits sichtbar ist.
Stanossek: Für uns Hauptamtliche sehe ich diese Möglichkeiten durchaus. Aber was ist mit Ehrenamtlichen? Besonders da vermisse ich Angebote, etwa für synodale Vertreter. Veränderung – was heißt das für Menschen, die sich seit Jahrzehnten im PGR engagieren? Und was heißt es, wenn auf einmal alles anders wird? Da sehe ich wirklich eine große Not.


 Bildergalerie
Bildergalerie 











